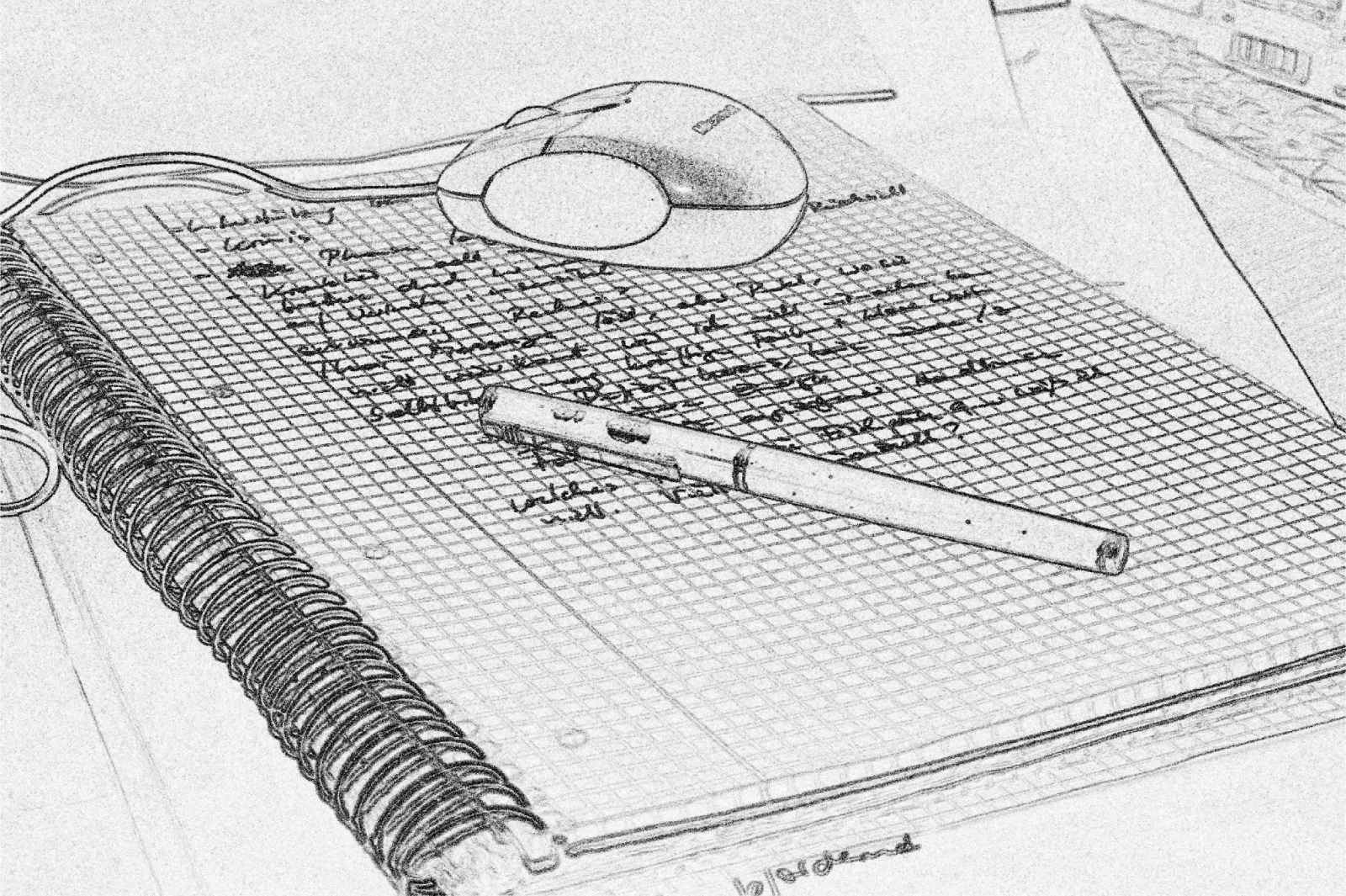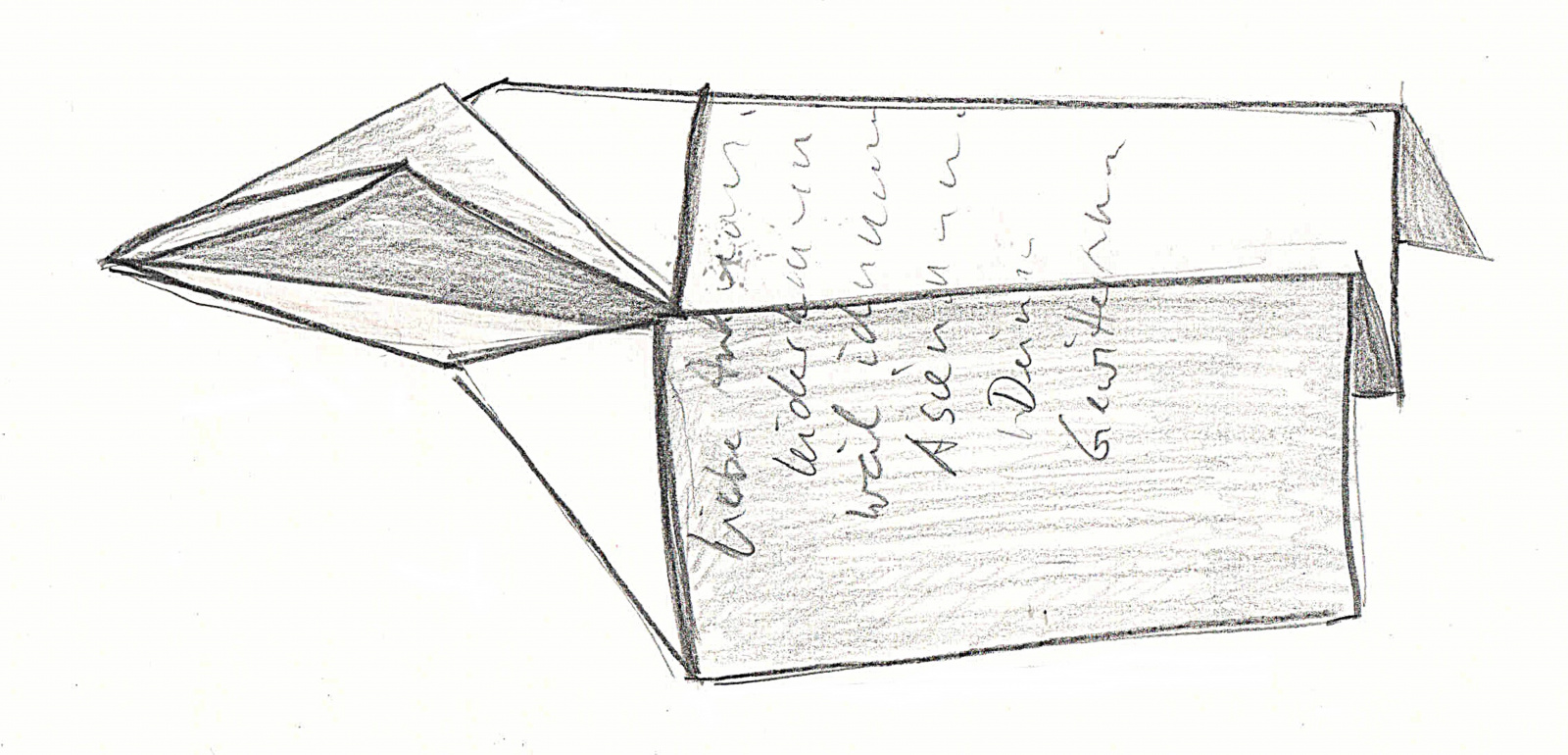Poesieblog
-
EVA kommt!
Es ist vollbracht! Am 13. September findet im Kultur: Haus Dacheröden die Buchpremiere zu unserer Anthologie »Eva träumt nicht mehr« statt. Darin Erzählungen und Gedichte, die von 2018 bis 2023 im Erfurter Kultur: Haus Dacheröden beim »Kreativen Schreiben« entstanden sind.
Eine mutige Frau im Schwimmbad. Ein Drehstuhl namens »Svindelik«. Zwei Kastanien, die als Filmstars vor der Kamera stehen. Ein Saugroboter, eine Tasche voller Geld, ein tyrannischer Toilettenmann: Die Auswahl versammelt Erzählungen und Gedichte, die von 2018 bis 2023 im Erfurter Kultur: Haus Dacheröden beim »Kreativen Schreiben« entstanden sind. Zu entdecken sind ganz unterschiedliche literarische Stimmen. Sie wollen Lesevergnügen bereiten und Lust machen, selbst zum Stift zu greifen.
Texte von:
Simone Börner | Ursula Bultmann | Rita Dorn | Anke Engelmann | Rainer Franke | Friederike Franz | Julia Herz | Katharina Hülle | Christina Schülerveröffentlicht: Anke Engelmann, Mittwoch, 24.07.2024
-
Gateless writing
Geschützter Raum, stärkenbasiertes Feedback, kein "Shitty first draw": Wertschätzende Kritik ist die Grundlage in meinen Seminaren.
Seitdem ich kreatives Schreiben unterrichte, achte ich auf wertschätzende Kritik. Auch in Schreibwerkstätten. Schließlich regt es mich selbst sehr auf, wenn jemand nur an meiner Arbeit herumkrittelt, ohne erst einmal mit etwas Posivitem bei mir die Tür zu öffnen. Zumindest ist zunächst einmal die kreative Leistung zu loben, denn man kann nur etwas kritisieren, das überhaupt vorhanden ist. Wie mutig ist es, sein Werk der Welt zu präsentieren! Zumal, wenn es gerade geschlüpft ist und man selbst ganz dünnhäutig ist. Deshalb soll Kritik auch immer von der eigenen Wahrnehmung ausgehen und nicht allgemein-pauschal von oben herab geäußert werden. Lange dachte ich, diese Herangehensweise wäre selbstverständlich, aber leider ist sie das nicht. Im Gegenteil.
Das heißt Gateless Writing, habe ich in der aktuellen Federwelt gelesen. Das Konzept habe die Neurowissenschaftlerin Suzanne Kingsbury entwickelt. Geschützter Raum. Klare Spielregeln. Positiver Fokus. Stärkenbasiertes Feedback. Rohdiamant statt "shitty first draw". Stress hemme den kreativen Fluss, lese ich.
Genau! Mach ich schon seit 2011! Wie gut das tut, höre ich nicht nur von meinen Teilnehmern. Mir selber gehts auch immer richtig gut nach jedem Workshop. Ist wie Wörterbaden!
veröffentlicht: Anke Engelmann, Montag, 17.06.2024
-
Heute ist Tag der Handschrift
Wer schreibt, bleibt, heißt es. Zum Beispiel mit einem Tagebuch.
Zwischen Schreibendem und Geschriebenem besteht eine enge Beziehung. Das eine strahlt auf das oder die andere - und umgekehrt. Kopf und Hand sind unmittelbar verbunden, die Gedanken fließen aufs Papier - ohne Ablenkung, ohne Barriere. Schreiben hilft, sich Geschehenes zu vergegenwärtigen und es zu bewältigen. Wer mit der Hand schreibt, merkt sich das Geschriebene besser als beim Schreiben auf einer Tastatur. Mit einem Stift auf einer Unterlage Buchstaben zu Wörtern zu Sätzen zu Texten zu reihen, das hat fast etwas Meditatives. Stirbt diese Kulturtechnik aus? Was fehlt dann? Heute ist Tag der Handschrift.
Zum Weiterlesen: Tag der Handschrift
veröffentlicht: Anke Engelmann, Dienstag, 23.01.2024
-
Statt den einen Krieg zu beenden, ist nun ein zweiter ausgebrochen. Dass in der DDR Israel kein Freundesland war, sondern die Guten in Palästina saßen, wo Arafat einen Befreiungskampf kämpfte, habe ich neulich kopfschüttelnd in einer Diskussion mit meiner Mutter erfahren müssen. Zur Haltung der Linken zum Überfall der Hamas empfehle ich den sehr klugen und differenzierten Artikel von Hans-Dieter Schütt.
veröffentlicht: Anke Engelmann, Mittwoch, 15.11.2023
-
Mehr Lesen! Intensiver lesen! Ausrufezeichen!
Die Zukunft des Lesens beeinflusst die Zukunft unserer Gesellschaften, warnen Leseforscher im Ljubljana-Manifest
Im "Ljubljana-Manifest zur Bedeutung fortgeschrittener Lesekompetenzen" warnen Leseforscher vor einem Verfall der Lesekultur. Die Bedeutung des intensiven Lesens müsse neu bewertet werden, fordern sie und weisen darauf hin, dass die Zukunft des Lesens die Zukunft unserer Gesellschaften beeinflusse. "Eine demokratische Gesellschaft, die auf einem informierten Konsens vielfältiger betroffener und interessierter Bürger*innen basiert, kann nur durch resiliente Leser*innen mit fortgeschrittenen
Lesekompetenzen erfolgreich sein und bleiben."
veröffentlicht: Anke Engelmann, Donnerstag, 19.10.2023
-
Lesung Eiapopeia
Wunderbar! Grandios!
Am Samstag habe ich im Café Landart gelesen und bin immer noch beseelt. Eine wunderbare Veranstaltung! Vielen Dank an Landart-Chefin Almut Keil und an die vielen interessierten und aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen. Und natürlich auch an den VS und den Verein Lese-Zeichen, die die Veranstaltung ermöglicht haben.
veröffentlicht: Anke Engelmann, Montag, 02.10.2023
-
Gut gemeint ist nicht genug!
Auch bei Texten in leichter und einfacher Sprache müssen Qualitätsstandards gelten. Das ist leider oft nicht der Fall. Menschen mit Handicap haben ein Recht darauf, dass sie wahrheitsgemäß informiert werden, und dass ihnen nichts Wichtiges vorenthalten wird.
Ich schlage mich gerade mit einen Text herum, der von einem großen Sozialträger (ich sage nicht, welchem) in leichte Sprache übersetzt wurde. Okay, der Originaltext ist sehr anspruchsvoll und dicht formuliert. Trotzdem sollte eine Übertragung fehlerfrei sein. Und das ist diese nicht. Ich habe im Netz recherchiert und eine Untersuchung gefunden, in der auch Probleme der leichten (und einfachen Sprache) angesprochen werden. Zum Beispiel Folgendes:
»Da sich die ursprünglichen Regeln für die Leichte Sprache vorwiegend aus der Praxis der sozialen Arbeit entwickelt haben, sind Erkenntnisse aus der Linguistik und Translationswissenschaft beim Prozess der Übertragung »Standard« nach »Leicht« kaum berücksichtigt worden. Zusätzlich steht für die Produktion von Texten in Leichter Sprache nicht fest, ob es sich um reine Übersetzungen, um Übersetzungen in Kombination mit Zusatztexten oder um eine Neufassung des ursprünglichen Textes handelt oder handeln sollte. [...]
Bei der Analyse von Leichte-Sprache-Texten finden sich außerdem noch immer Probleme bei der Qualitätssicherung. Bereits einfache, allgemein bekannte Aspekte der Textqualität wie Konsistenz in Schreibweise und Bezeichnung werden oft nicht eingehalten. [...]
In einzelnen Verständlichkeitstests kann jedoch gezeigt werden, dass die Regeln zur Leichten Sprache nicht immer zur Verständlichkeit beitragen. [...]
Die in der Praxis der sozialen Arbeit erstellten Verständlichkeitsregeln [haben] z. T. keine linguistische Basis. [...]Textzusätze oder Erklärungen von Übersetzerinnen und Übersetzern beispielsweise in medizinischen Ratgebern in Leichter Sprache [erscheinen] als besonders problematisch. Eine Analyse zeigt, dass diese Textzusätze sogar Fehlinformationen enthalten können.«
Zum Weiterlesen: https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/20144/2/2020_Jekat-Hagmann-Lintner_Texte-in-Leichter-Sprache.pdf
veröffentlicht: Anke Engelmann, Mittwoch, 30.08.2023
-
Im Deutschen sind Männer immer weiblich
Vom Reichtum unserer Sprache
Unsere Sprache, das sind die Geschichten, die die alten Wörter tragen. Das ist die fließende Prosa eines gut geschriebenen Romans ebenso wie das Stakkato eines Rap-Gesangs, der über’n Hinterhof schallt. Das sind Humor, Erfindungsreichtum und der kreative Witz des deutschen Volksmundes. Sprache ragt aus der Vergangenheit in die Zukunft. Was für eine Fülle! Was für ein Schatz, der urdemokratisch allen gehört! Eine lebendige Substanz aus Bedeutung, Formen und Strukturen, die sich weitgehend selbst reguliert und gesellschaftlichen Veränderungen anpasst.
Natürlicher Sprachwandel braucht Zeit. Regelungen per Dekret werden als Zwang empfunden, als Ein- und Übergriff in zutiefst Privates. Der Asterisk zum Beispiel, auch Genderstern genannt. Er soll Kategorien anzeigen, die, glaubt man Umfragen und dem eigenen Eindruck, dem überwiegenden Teil der Sprachbenutzer völlig schnuppe sind. Vielleicht genau deshalb soll er irritieren und stören. Er sprengt die Wortgrenzen und zerhackt den Fluss der Gedanken, die sich artikulieren wollen. Der Asterisk kommt als Platzhalter aus der Computersprache. Er mutet so ahistorisch und unsensibel an, als wäre jemand – »Ei, was nehmen wir denn da?« – mit dem Zeigefinger über der Tastatur gekreist. Das bringt die Menschen auf. Wer braucht ein solches Ungetüm?
Der Normalbürger nicht. Er fühlt sich schon genug gegängelt von den kleinen Alltagsgemeinheiten deutscher Bürokratenseelen. Jetzt auch noch die Sprache! Permanent soll man um Fettnäpfchen und Tretminen herumeiern, mit uncharmantem Sprech, sperrig und unsexy. Sternchen hacken die Wörter in immer dünnere Scheiben (»Bürger*innenmeister*in«), Kongruenz funktioniert nicht mehr intuitiv, sondern man verheddert sich heillos, will man alles unter einen Hut bringen (»Ein*e kompetente*r Bürger*innenmeister*in«). Immer bürokratischer wird die Sprache, mit jedem genderneutralen Passiv, mit jeder »-schaft«-Wortbildung, mit jedem inflationären Gebrauch des Partizip I, der die Verlaufsform sprengt.
Alle sollen gemeint sein. Wenige fühlen sich angesprochen. Viele werden ausgeschlossen. Da würde es auch nichts helfen, der Buchstabenreihe (Achtung: englisch aussprechen!) LBGTQAI+, die sich aktuell hinter dem Stern schart, und die für marginalisierte und bislang unsichtbare Gruppen stehen soll, weitere hinzufügen: O zum Beispiel für Ossi. Oder Ü50. Nein, inklusiv geht anders. Schreib- und Leseunkundige, die sich mühsam, Buchstabe für Buchstabe, die Wörter und ihre Bedeutungen erschließen, irritieren die Zeichen und die abstrakte Kategorie, für die sie stehen. Sie bilden eine Barriere und versperren die Teilhabe am Schriftdeutsch. Inklusive Sprache ist nicht inklusiv. Sie ist exklusiv, erschaffen von und für Menschen mit akademischem Hintergrund, die trotz aller Bildung keine Ahnung von Grammatik haben.
Zum Beispiel übergehen sie die althergebrachten Genusmarker des Deutschen: die Artikel. Dabei zeigen die sich, genau wie die Personalpronomen, im Plural genderfluid stets in weiblicher Form. Grammatisch gesehen sind im Deutschen mehrere Männer (»sie«) immer weiblich. Zudem wäre es hilfreich, überkommene Begriffe auszumisten, denn seit Beginn der Grammatikschreibung des Deutschen werden die Kategorien Genus (grammatische Kategorie) und Sexus (biologisches Geschlecht) in einen Topf geworfen, was wesentlich zur Verwirrung beigetragen hat. Man könnte weiblich/feminin in DIE-Form umbenennen, männlich/maskulin in DER-Form, sächlich/neutrum in DAS-Form. Wären so nicht das Gender-Problem und das generische (sogenannte) Maskulinum zumindest auf der formalen Ebene elegant entschärft?
Leider nicht. Denn längst geht es um mehr. Das zeigt die Auseinandersetzung um Joanne K. Rowling. Der Erfolgsautorin brauste 2020 ein Shitstorm um die Ohren, der auch sexistische Beschimpfungen, Vergewaltigungsandrohungen und öffentliche Bücherverbrennungen einschloss – und zwar von Menschen, die sich als links begreifen. In diesem Zusammenhang entstand ein neues Kunstwort: TERF, »Trans Exclusionary Radical Feminist« (»radikale Feministin, die Transmenschen ausschließt«).
Denn auch Feministinnen gehören nicht per se zu den Guten. Nicht, wenn sie an der antiquierten Vorstellung festhalten, dass es biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, Verzeihung, zwischen Personen mit und ohne Uterus. Joanne K. Rowling ist TERF, Alice Schwarzer ist es. Und ich bin es auch. Wie Rowling und Schwarzer bin ich dagegen, dass Schutzräume für Frauen, denen Männer Gewalt angetan haben, auch (Pardon) »Trans-Menschen mit Penis« offenstehen sollen. Rowling reagierte mit einem lesenswerten Essay, dem man das Bemühen um Ausgewogenheit anmerkt.[1]
Welchem Geschlecht, ob biologisch oder sozial konstruiert, mein Gegenüber sich zuordnet, ist mir in aller Regel völlig schnuppe. Ich möchte nicht immerzu mit der Nase darauf gestoßen werden. Wem hilft es, wenn Marginalisierte sich einen Opferstatus erkämpfen? Das verschleiert die wirklichen Widersprüche und bindet Kräfte in Stellvertreterkriegen. Dieser Kulturkampf macht mir Angst, die Melange aus moralischer Entrüstung, Pedanterie und George Orwell. Mich regt die unerschütterliche Selbstgewissheit von Leuten auf, die meinen, immer recht zu haben, weil sie auf der Seite der Unterprivilegierten und Verfolgten stehen. Denn das hat Mao Tse-tung auch behauptet. Und Stalin.
Am Glottisschlag, dem Pause gewordenen Genderstern, erkennt man, wer sich dazuzählt. Doch der Glottisschlag reicht nicht. Man ist genötigt, sich ständig selbst zu kontrollieren. Ist mir – o Schreck! – ein N-, M-, oder I-Wort herausgerutscht? Neue Retortenwörter sollen die belasteten Begriffe ersetzen, POC (»people of color«) zum Beispiel für Menschen mit dunkler Hautfarbe. POC! Wie kann man sich sicher in der Muttersprache bewegen, wenn Wörter von einem Tag auf den anderen nach Rassismus, Patriarchat, kolonialer Unterdrückung, alten weißen Männern, Mehrheitsgesellschaft und Heteronormalität stinken? Wie kann man sich an ihr erfreuen, wenn man von staubtrockenen Akronymen umgeben ist? Wörter können nicht böse sein. Nur die, die sie benutzen.
Jeder soll so sprechen, wie der Schnabel gewachsen ist. Auch die inklusive Sprache sei niemandem verboten. Ich begrüße jeden Sprachwandel und ich freue mich, dass unser Bewusstsein für Ungerechtigkeiten und Ausgrenzungen in den letzten Jahren so stark gewachsen ist. Dass die Diskussion um die Sprache uns bewusst macht, wie privilegiert und auf wessen Kosten wir leben. Aber niemandem dürfen sprachlichen Verrenkungen wie die oben beschriebenen aufgenötigt werden.
Schnell werden Kritiker mit der AfD in einen Topf gesteckt, oder schlimmer noch, in den sozialen Medien mit Dreck beworfen. Wer eine Moralkeule in der Hand hält, differenziert nicht. Er knüppelt drauflos. Zu den Vorrechten der Jugend gehört es, Forderungen zu stellen, die übers Ziel hinausschießen. Aber so geht das nicht! Man muss auch Sachen aushalten, die einem nicht gefallen! Zum Beispiel, dass nicht jede Peer-Group eine Dependance in der Sprache eröffnen kann.
Es ist die Aufgabe des Alters, ein Gegengewicht herzustellen, sodass sich die Gegensätze ausbalancieren können. Aber wo sind sie, die Alten, die Kulturbewahrer? Im Juli 2022 haben sich Wissenschaftler mit einem Offenen Brief aus ihrem Elfenbeinturm gewagt und sich gegen den Glottisschlag im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk ausgesprochen: Germanisten, Linguisten, Übersetzer, Koryphäen in den Neunzigern, als ich Linguistik studiert habe.[2] Zwei Jahre zuvor, im Juli 2020, hatten Intellektuelle und Künstler aus dem englischsprachigen Raum mit einem Offenen Brief für freie Meinungsäußerung plädiert.
»Der freie Austausch von Informationen und Ideen, das Lebenselixier einer liberalen Gesellschaft, wird täglich immer enger«, warnten die 152 Unterzeichner, zu denen neben Rowling u.a. Noam Chomsky, Margaret Atwood, Salman Rushdie und Daniel Kehlmann gehören. Sie konstatierten »eine Intoleranz gegenüber gegensätzlichen Ansichten, eine Vorliebe für öffentliche Schande und Ächtung und die Tendenz, komplexe politische Fragen in einer blendenden moralischen Gewissheit aufzulösen«.[3] Prompt wurde der Brief in den sozialen Medien als »Reaktion einer privilegierten Elite auf die Infragestellung ihrer kulturellen Hegemonie« gegeißelt, woraufhin einige der Unterzeichner wieder absprangen.
Der Reichtum unserer Sprache spiegelt unseren kulturellen Reichtum. Ihn muss man teilen, ihn muss man verschenken. Er ermöglicht Freiheit, und zwar allen. Gerade wer aus der DDR kommt, kennt die subtile Schizophrenie der Anpassung und sollte es vehement ablehnen, sich neben der privaten eine öffentliche Sprache anzutrainieren, die ideologisch motiviert ist. Schon jetzt werden an einigen Universitäten Hausarbeiten ohne Asterisk bei der Bewertung eine Note herabgestuft. »Wenn wir nicht genau das verteidigen, wovon unsere Arbeit abhängt, können wir nicht erwarten, dass die Öffentlichkeit oder der Staat es für uns verteidigen.«[4], heißt es in dem Offenen Brief aus Übersee. Dem kann ich mich nur anschließen.
Anke Engelmann hat Germanistik mit dem Schwerpunkt Sprachgeschichte und Linguistik studiert. Sie unterrichtet Alphabetisierung und kreatives Schreiben und ist als Schriftstellerin, Lektorin, Journalistin und Herausgeberin tätig.Quellen:
[1] Essay von J. K. Rowling, abgedruckt in der Emma September/Oktober 2020 [19.1.2023][2] Linguistik vs. Gendern. Offener Brief deutscher Sprachwissenschaftler vom Juli 2022 [13.9.2022]
[3] Offener Brief von Intellektuellen, Schriftstellern und Künstlern vom 7. Juli 2020 [19.1.2023], (Übersetzung der Autorin)
[4] ebda.
Der Beitrag erschien im Palmbaum, Literarisches Journal aus Thüringen (Hg. Jens-Fietje Dwars), Quartus Verlag Bucha bei Jena, Heft 1/23
veröffentlicht: Anke Engelmann, Dienstag, 15.08.2023 in Gender, Gutes Deutsch, Sprachpolitik
-
Sklave von Jeff Bezos
Amazon und Bücherliebe
In der Frankfurter Rundschau erzählt der Antiquar Wolfgang Rüger von seiner Liebe zu Büchern und was es für ihn bedeutet, auf Amazon zu verkaufen. Unbedingt lesen! Darf man nach der Lektüre eigentlich noch bei Amazon bestellen?
veröffentlicht: Anke Engelmann, Donnerstag, 13.07.2023
-
Mauersegler im Bücherkubus
In der Weimarer Herzogin Anna Amalia Bibliothek ehren Freunde und Weggefährten den verstorbenen Lyriker Wulf Kirsten
Ob es ihm an diesem Abend zu laut gewesen wäre? In einer Bibliothek hat schließlich Stille zu herrschen. Bestimmt hätte der Dichter Wulf Kirsten diesmal eine Ausnahme gemacht. Denn seine Gedichte lernte er nach eigenem Bekunden erst beim lauten Lesen richtig kennen. Und maß sie an der Reaktion des Publikums, dem Beifall und der Qualität der Stille.
Publikum ist reichlich anwesend, jeder Platz im Bücherkubus der Herzogin Anna Amalia Bibliothek (HAAB) ist besetzt. Eingeladen haben die Stadt Weimar, die HAAB und die Gesellschaft der Anna Amalia Bibliothek, die Literarische Gesellschaft Thüringen sowie der Thüringer Literaturrat. Familie, Freunde, Weggefährten und Dichterkollegen begrüßen einander. Man nickt sich zu, schüttelt Hände an diesem warmen Sommerabend kurz nach der Sommersonnenwende, dem Geburtstag des 2022 verstorbenen Lyrikers.Das Podium spricht über Kirsten, vor allem aber spricht es mit ihm, indem es ihn zitiert. Jeder trägt sein oder ihr Lieblingsgedicht vor. Begeistert und auswendig Pia-Elisabeth Leuschner vom Lyrik Kabinett München, vorsichtig tastend der Romanist Eduardo Costadura, die Worte auskostend der Lyriker Jan Volker Röhnert, mit verschmitzter Entdeckerfreude der Herausgeber Jens-Fietje Dwars – alles klug moderiert von Christoph Schmitz-Scholemann. Die kräftige Sprache lässt keine Wehmut aufkommen, es prasselt, rollt, es zwitschert, und die Gedichte verströmen ihr Bukett, deutsch, italienisch bei Eduardo Costadura, französisch bei Kirsten-Übersetzer Stéphane Michaud, der extra aus Paris angereist ist.
Kein Gourmet-Schnickschnack, nein, ein handfester Landwein wuchs aus der Erde bei Meißen. Von Mauerseglern ist die Rede und vom Obstpflücker Oswin aus dem Armenhaus. Von der Wirtstochter Margarete, der Franz Kafka in Weimar nachstieg. Von Landschaften und Landwirtschaft. Von Sachen und Satzanfängen, von Erdung, von Sinnlichkeit. Poesie als Weltsprache, versunkene Wörter, »gediegene Frankophonie« und obersächsische Mundart, und man schmeckt die Worte im Gaumen und sinnt den erdfarbenen Bildern nach, die sie erzeugen. Die literarisch Gebildeten im Podium stellen Bezüge her zu Hölderlin, Rilke oder Goethe. Interessant, denkt man, ein doppelter Boden. Es braucht ihn nicht, damit diese Lyrik einen ergreift, doch ihr wächst damit eine weitere Dimension zu.
Wieviel bleibt heute von dieser Tiefe, wenn Germanistik-Studenten Goethe nicht rezipieren und Schüler Gedichte nicht lernen müssen? Wenn jeder vierte Viertklässler nicht gut lesen und schreiben kann, Bibliotheken verwaisen und Literatur als Digitalisatbrei im smarten Einheitslook daherkommt? Wulf Kirstens enzyklopädisches literarisches Wissen, sein akribisches Sprachgefühl scheinen aus dieser Zeit gefallen. Und doch, mit seinen genauen Beobachtungen und seiner Verbundenheit zur Natur, seinem beharrlichen Einsatz gegen ihre Zerstörung und die Hybris der Menschen kann er gerade für die Generation Klimakatastrophe eine große Entdeckung sein.
Vielleicht hilft dabei ein letztes Buch: »Nachtfahrt« heißt der Band mit Texten aus dem Nachlass, den Jens-Fietje Dwars im quartus Verlag herausgegeben und den Susanne Theumer mit Grafiken illustriert hat. Und in der HAAB kann man künftig Wulf Kirstens poetischen Kosmos erkunden. Wie Bibliotheksdirektor Reinhard Laube ankündigt, findet Kirstens Lyriksammlung hier ein neues Zuhause. 65 Regalmeter Poesie, in einem langen Leben gesammelt, verdaut und verdauert. In einer Leselounge, die im nördlichen Teil der Bibliothek entsteht, kann man auf lyrische Entdeckungsreise gehen. Und hört dabei vielleicht die Mauersegler im Kubus kreisen.
Wulf Kirsten: »Nachtfahrt. Autobiografische Prosa aus dem Nachlaß« Herausgegeben von Jens-Fietje Dwars. quartus Verlag, Weimar, 2023, ISBN 978-3-947646-52-4Die Veranstaltung wurde mitgeschnitten und ist am 1. August auf Radio Lotte und ab 2. August als Podcast unter www.literaturland-thueringen.de nachzuhören.
veröffentlicht: Anke Engelmann, Samstag, 08.07.2023
-
Der Affe Arthur und gustaf, der Geier
Eselsbrücken-Geschichte zum Erlernen der Zehn-Finger-Schreibtechnik
Tastatur-Geschichte:
linke Hand:
A wie Affe Arthur gelb
S wie Segeln, See blau
D wie Deich grün
F wie Fahne(nstange) rot
G wie geier gustaf rotQ (von A) wie Quast gelb
W (von S) wie Wasser blau
E (von D) wie Eimer grün
R (von F) wie rot rot
T (von T und G) wie Taschentuch, Tomate rotY (von A) wie Yacht gelb
A, Q, Y, 1, 2, !
X (von S) wie Xugaman (Handtuch) blau
C (von D) wie Chaussee grün
V (von F) wie Vogel rot
B (von F und G) wie Baum, Buche rot
S, W, X, 3, „
D, E, C, 4, $
F, R, V, 5, %
G, T, B, 6, &Der Affe Arthur war gelb und reiselustig. Eines Tages segelte er ganz allein über einen tiefblauen See, und zwar so lange, bis er an einen Deich kam, der war grasgrün. Auf dem Deich stand eine einsame Fahnenstange, auf der saß ein dünner roter geier, der hieß gustaf mit f.
Arthur hatte etwas ganz Besonderes: An seinem Schwanz war ein dicker gelber Quast. Fast wie bei einem Löwen! Das hat nicht jeder Affe. Die meisten können nur einen kleinen Stummelschwanz ihr eigen nennen. Dieser Quast war Arthurs ganzer Stolz.
Noch etwas war an Arthur anders als an anderen Affen: Arthur war ein besonders furchtloser Affe. Obwohl er beim Segeln völlig von Wasser umgeben war - Affen mögen das nicht besonders - hatte er keine Angst. Er plantschte mit seinem Quast im Wasser wie ein Maler mit seinem Malerpinsel.
Arthur war ausgestiegen und als er auf dem Deich näher kam, entdeckte Arthur einen Eimer aus grüner Plaste. Der war so grün, dass sich das Gras ringsum schämte und versteckte, denn wie konnte ein schnöder Plasteeimer grüner sein als das Gras selbst?
Und die Fahnenstange war schon ganz alt und die Farbe blätterte ab. Aber ursprünglich war sie für eine rote Arbeiterfahne gedacht. Das wusste aber nur gustaf der geier. Und der schwieg.
An der Fahnenstange flatterte ein Taschentuch. Der Affe hatte keine Angst, nein Arthur doch nicht. Aber er wollte den Geier nicht erschrecken. Deshalb schlich er sich vorsichtig nach Affenart an. Und da bemerkte er, dass auf das Taschentuch eine knallrote Tomate gestickt war.
Der Affe Arthur hielt inne und warf einen Blick zurück auf seine Yacht, die am gelben Strand lag. Vom Segeln war er ganz nass geworden, vor allem sein Quast. Und weil er Fremdländisch sprach, rief er ganz laut: Xugaman? Das bedeutet Handtuch. Und noch einmal: Xugaman? Niemand antwortete.
Und so erkletterte er den Deich und entdeckte auf der anderen Seite eine Chaussee, die war fast so grün wie der Deich. Arthur drehte sich noch einmal um und sah zu der Fahnenstange zurück. Da stiegen von der Fahnenstange ganz viele rote Vögel auf. Arthur entdeckte auch den roten geier. Die Vögel und der geier lärmten und kreisten eine Weile um die Fahnenstange, über den Deich und den Eimer. Dann setzten sie sich auf einen Baum auf der rechten Seite der Chaussee, das war eine rote Buche. Natürlich musste gustaf der geier auf der Spitze des Baumes Platz nehmen. Ihn interessierte kein bisschen, dass sich der Baum gefährlich nach links bog. Und dass Arthur, der Affe, den Kopf ganz schief machen musste.
(Diese Geschichte wurde mit 6 Fingern geschrieben.)
veröffentlicht: Anke Engelmann, Mittwoch, 12.04.2023
-
Worüber darf man heutzutage noch lachen, in diesen woken Zeiten? Schöner Beitrag auf RND.
veröffentlicht: Anke Engelmann, Sonntag, 02.04.2023
-
Richtiger Ansatz, falsche Richtung
Kulturrat will mit Basishonoraren die Situation soloselbständiger Künstler verbessern
Im Herbst hatte die Kulturministerkonferenz (KMK) eine entsprechende Matrix beschlossen. Vor allem in der Corona-Zeit sei deutlich geworden, wie gering die Einkommen der Soloselbständigen in Kultur und Medien seien, so Kulturrat und KMK. »Der entscheidende Schlüssel zur Verbesserung der sozialen Lage der Soloselbstständigen im Kultur- und Medienbereich ist darum die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage«, so der Kulturrat.
So weit, so gut. Aber ob verbindliche Basishonorare dabei der richtige Weg sind? Ich zum Beispiel halte lieber eine Lesung für handfeste 250 Euro als keine Lesung, bei der ich 400 Euro bekommen hätte. Eine große Hilfe wäre zunächst der uneingeschränkte Zugang für Selbständige zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung. Das wurde uns im Lockdown versprochen. Und? Kurz wurden die Beschränkungen aufgehoben. Längst ist alles auf dem Status vor der Pandemie.
Presseerklärung des Deutschen Kulturrates vom 22. März 2023veröffentlicht: Anke Engelmann, Dienstag, 28.03.2023
-
Spaß mit Erika
Kürzlich erhielt ich eine Mail von einem meiner Teilnehmer im Uni-Kurs »Kreatives Schreiben«. Sein Laptop war kaputt und aus Not hat er mit einer Schreibmaschine gearbeitet. Und war begeistert. »Schreibmaschinen bauen automatisch eine Achtsamkeit für das eigene Schreiben auf«, schreibt er.
Vor einiger Zeit hatte ich den Ehrgeiz, wieder mit der Schreibmaschine zu schreiben. Ich kramte meine alte Erika heraus, besorgte mir Farbband (jawohl, das gibt es noch) und tippte wild drauflos. So wie als Kind, bei meiner Oma auf der Arbeit. Wie als Jugendliche in der DDR, als ich ganze Bücher abgetippt habe – die hatte man dann wirklich gelesen. Wie in meinen ersten Studienjahren in den Neunzigern, bei Referaten und Hausarbeiten. Hat leider nicht gut funktioniert – ich arbeite gern mit dem Computer und genieße es, dass ich nicht bei jeder Änderung alles abschreiben muss. Wie haben die Schriftsteller früher eigentlich gearbeitet?
Kürzlich erhielt ich eine Mail von einem meiner Teilnehmer im Uni-Kurs »Kreatives Schreiben«. Sein Laptop war kaputt und aus Not hat er mit einer Schreibmaschine gearbeitet. Und war begeistert. »Schreibmaschinen bauen automatisch eine Achtsamkeit für das eigene Schreiben auf«, schreibt er. Mit seiner Erlaubnis stelle ich seine Erkenntnisse auf meinen Blog.
»Meine Freundin hatte mir irgendwann eine Erika geschenkt, weil sie der Meinung war, dass das gut zu mir passen würde. Sie sollte recht behalten. Schreibmaschinen bauen automatisch eine Achtsamkeit für das eigene Schreiben auf. Ich bin ein durch Selbsthass und Nihilismus durchtriebener Mensch, speziell im Schreiben. Durch die Schreibmaschine konnte ich meinen Werken Wert zuschreiben und das Eigene schätzen lernen. Sowas war mir vorher nie möglich. Wenn ich Gedichte hingekliert habe (in meiner Sauklaue) oder am PC Geschichten geschrieben habe, habe ich zunächst alles gehasst, was aus mir rauskam. Über meine Erika habe ich dann die Wertschätzung zu sich selbst und zu dem Geschaffenen erlernt. Nicht, dass meine Schriften sofort qualitativ besser wurden, aber allein der Stolz: »Ich habe was erschaffen und jetzt ist es (ansehnlich) auf Papier und das hat schon immensen Wert!« hat mir viel Kraft im Schreiben, aber auch im Persönlichen gegeben. Die Identifikation mit dem Eigenen wurde einfacher bzw. die Schritte dahin offener. […]
Das ist ein ganz kurzer Anriss von mir und meiner Erika. Ohne sie wäre das Leben schwerer aber die Nächte für die Nachbarn leiser (klimper, klimper). Akademische Texte und Arbeitstexte verfasse ich aber weiter auf dem Rechner. Die teure Reparatur muss sich ja gelohnt haben! Nein, Spaß, das hat wohl eher zeittechnische Gründe.«
veröffentlicht: Anke Engelmann, Dienstag, 28.03.2023
-
Zum Tod des Dichters Wulf Kirsten
Die Thüringer Literaturszene hat Wulf Kirsten unendlich viel zu verdanken. Am 14. Dezember ist er 88-jährig gestorben.
Am 14.12.2022 ist der Schriftsteller Wulf Kirsten verstorben. Dies teilte die Familie Kirsten mit. Wulf Kirsten wurde 88 Jahre alt. Mit ihm verliert Deutschland einen seiner bedeutendsten Lyriker, dessen Gedichte in zahlreiche Fremdsprachen, unter anderem ins Französische und Koreanische übersetzt wurden. Wulf Kirsten wurde für sein Werk mit mehreren renommierten Preisen ausgezeichnet. Neben seinem Wirken als Lyriker trat er auch als Essayist, Erzähler und Herausgeber bedeutender Anthologien hervor. Darunter die Lyriksammlung »Beständig ist das leicht Verletzliche« mit Gedichten von Friedrich Nietzsche bis Paul Celan.
In der Wendezeit gehörte er zu einem der führenden Köpfe der friedlichen Revolution in Weimar. Kirsten, der 1934 in Klipphausen bei Meißen geboren wurde, siedelte 1965 nach Weimar über, wo er bis 1987 Lektor beim Aufbau-Verlag war. Über mehr als ein halbes Jahrhundert war er eine der prägenden Persönlichkeiten des kulturellen Lebens der Klassikerstadt. Die Erinnerung an die NS-Vergangenheit lag ihm besonders am Herzen, was sich mehreren Büchern, zum Beispiel der Anthologie »Stimmen aus Buchenwald« niederschlug.
Die Thüringer Literaturszene hat Wulf Kirsten unendlich viel zu verdanken. Er war nicht nur Mitgründer der Literarischen Gesellschaft Thüringen, er initiierte auch die »Thüringen-Bibliothek« (seit 2000 »Edition Muschelkalk«), setzte sich für die Einrichtung des Thüringer Literaturpreises und des Literaturstipendiums »Harald Gerlach« ein und förderte zahlreiche junge Autorinnen und Autoren auf ihrem Weg.
Der Tod Wulf Kirstens hat uns alle bestürzt. Wir verlieren mit ihm einen großen Dichter, unermüdlichen Anreger und Freund.
Auf der Webseite des Thüringer Literaturrates hat Christoph Schmitz-Scholemann einen Nachruf geschrieben
veröffentlicht: Anke Engelmann, Freitag, 16.12.2022